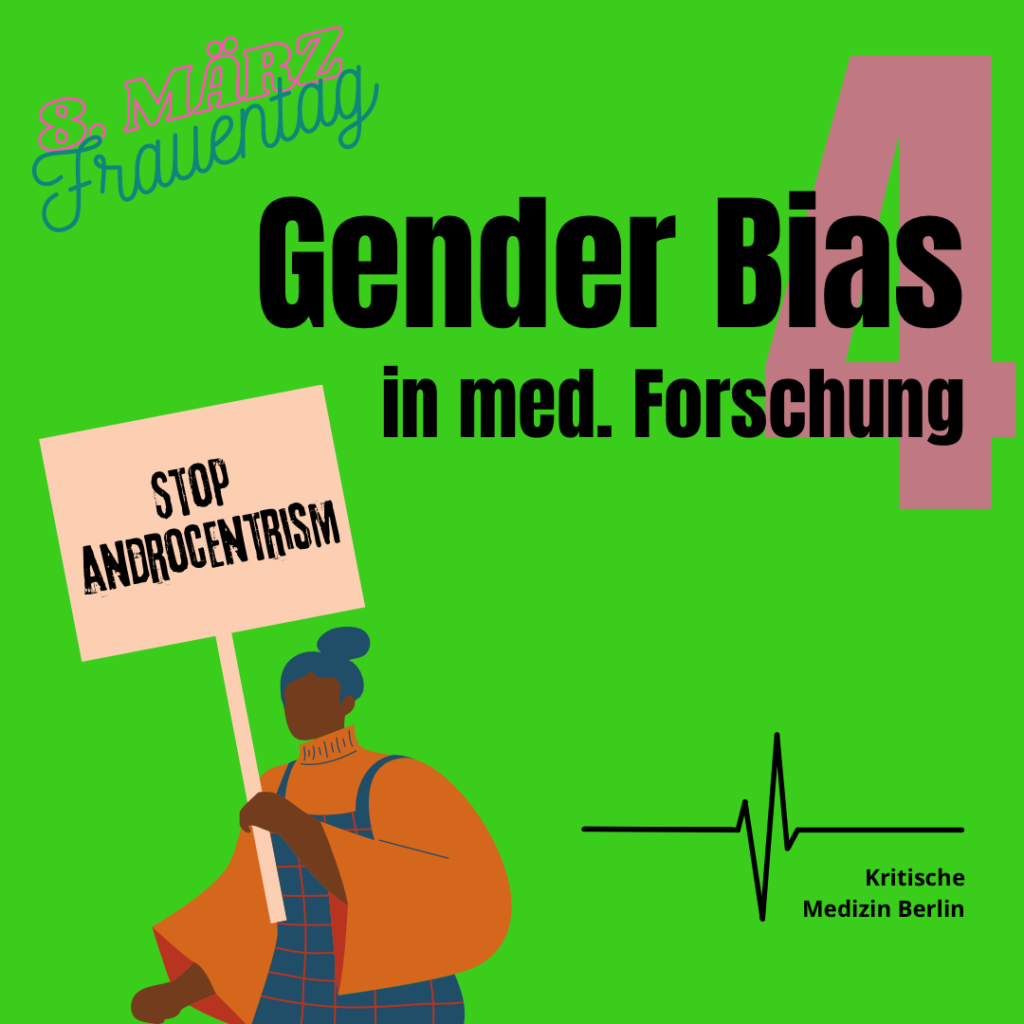#5 Female Genital Mutilation
Triggerwarnung: In diesem Text wird von sexistischer Gewalt und Körperverletzung gesprochen.
Female Genital Mutilation (FGM) beschreibt laut WHO alle Verfahren, die die teilweise oder vollständige Entfernung der weiblichen äußeren Genitalien oder deren Verletzung zum Zielhaben, sei es aus kulturellen oder anderen, nichttherapeutischen Gründen.
Im Deutschen wird auch häufig die Bezeichnung „Weibliche Genitalverstümmlung“ verwendet. Diese beschreibt zwar das Ausmaß der Gewalt des Eingriffs, kann in der Arbeit mit Betroffenen aber als Abwertung oder Defizit wahrgenommen werden.
Eine andere häufig verwendete Bezeichnung – „Weibliche Beschneidung“ – suggeriert, dass der Eingriff vergleichbar mit männlicher Beschneidung wäre und kann so euphemistisch wirken.
Im folgenden Text wird die International weitläufige Abkürzung FGM verwendet.
Weltweit sind schätzungsweise mindestens 200 Millionen weiblich sozialisierte Personen von FGM betroffen. Jährlich erfahren laut UNICEF ca. 3 Millionen Personen FGM, das sind fast 3000 pro Tag.
Ungefähr 25% davon sterben während des Eingriffs oder an seinen Folgen.
FGM wird in 30 Ländern ausgeübt, welche sich geografisch vor allem auf Nordost-, Ost und Westafrika konzentrieren. Auch Länder, welche dem sogenannten „Nahen Osten“ zugeordnet werden oder im südöstlichen Asien sind betroffen, wie auf dieser interaktiven Karte visualisiert.
In Europa leben mittlerweile 1 Millionen Personen die FGM durchlebt haben oder davon bedroht sind. Nicht wenige davon leben in Deutschland.
Es zeigt sich: FGM ist kein Verfahren, welches einem einzelnen Land, einer bestimmten Religion oder Kultur zuzuordnen ist. Deshalb variieren die Verfahren in ihrer Ausführung teilweise sehr.
Laut WHO lässt sich die FGM jedoch in vier Typen einteilen, davon sind die ersten beiden am meisten Vertreten.
Der Typ I bezeichnet alle Verfahren in denen die Clitoris vollständig oder partiell entfernt oder beschädigt wird (Klitoridektomie) während beim Typ II ebenso die Schamlippen betroffen sind (Exzision)
Beim Typ III werden, unabhängig davon, ob die Verfahren des Typ I und II stattgefunden haben, die Schamlippen zusammengenäht (Infibulation) Die zurückbleibende Öffnung ist verengt, das Ausmaß unterscheidet sich. Der Typ IV bezeichnet alle anderen verletzenden Eingriffe an den weiblichen Äußeren Genitalien.
FGM wird ab dem Säuglingsalter vorgenommen und findet durchschnittlich zwischen dem 4. Und 12. Lebensjahr statt.
Meist führen ältere Frauen* FGM unter unhygienischen Bedingungen und ohne Betäubung durch. Als „Werkzeug“ werden dabei Rasierklingen, Glasscherben, Scheren oder Findernägel verwendet.
Die Begründungen für die Durchführung von FGM variieren stark so wie Traditionen in dessen Rahmen sie vorgenommen wird. Oft steht dabei die „Jungfräulichkeit“ der Betroffenen im Vordergrund. Die weiblichen Genitalien werden als schmutzig und hässlich betrachtet. Beispielsweise gibt es die Annahme, die Klitoris sei giftig und gefährde die Gesundheit aller, die sie berühren. Andere Gründe sind die Überzeugung einer Fruchtbarkeitssteigerung durch den Eingriff oder der vermeintliche Schutz vor der eigenen „unkontrollierbaren“ Sexualität oder Vergewaltigung.
Diese Gründe sind alle höchst sexistisch und genauso entmenschlichend und gewaltvoll, wie der Eingriff selbst. Sie gehen alle mit dem Hauptgrund einher, dass ein gemeinschaftlicher Zugzwang herrscht. Nicht Betroffene werden stigmatisiert, als minderwertig und nicht heiratswürdig betrachtet oder sogar aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Neben vielen akut-physischen Folgen, wie beispielsweise schweren Blutungen, einer Blasenlähmung oder einer Infektion mit HIV, haben Betroffene langfristig teilweise unaushaltbare Schmerzen beim Urinieren oder der Menstruation.
Die Folgen für die Sexualität variieren bei Betroffenen. Geschädigtes Lustempfinden und Abwesenheit von sexuellem Verlangen sind unter Anderem maßgeblichen von den psychischen Folgen des Eingriffs bestimmt. Die Traumata, die die Betroffenen durchleben mussten, können auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen.
Die vermehrte Flucht aus Ländern, in denen FGM durchgeführt wird, kann in Deutschland erfolglos sein, wenn Betroffene Durchlebtes vor Behörden nicht detailliert und wiederholt Darstellen wollen oder können, beispielsweise weil sie an den genannten psychischen Folgen leiden. Erst seit 2004 ist FGM implizit als Fluchtursache im deutschen Gesetz verankert. Eine Anerkennung setzt aber neben der detaillierten Schilderung und damit evtl. einhergehenden Retraumatisierung auch bei Rückkehr drohende Menschenrechtsverletzungen voraus, welche bei Betroffenen ja bereits stattgefunden hat.
Betroffene sind nach der Flucht häufig nicht nur stigmatisiert oder aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und haben gar keinen Ort mehr zu dem sie zurückkehren könnten. Eine Rückkehr ist, jedoch unabhängig vom exakten Grund, immer unzumutbar.
Weiblich sozialisierte Personen, die in Deutschland leben und/oder aufgewachsen sind, durchleben FGM meist außerhalb Deutschlands in Ländern beziehungsweise Gemeinschaften, zu denen ihre Familien sich zugehörig fühlen (sog. „Ferienbeschneidung“).
Um das zu verhindern wurde 2016 in Deutschland ein Gesetz verabschiedet, welches in diesem Falle mit einem Entzug des Passes droht. Dieses Gesetz ist zwar ein Versuch Betroffene zu schützen, indem man durch Machtdemonstration des Staates abschreckt. Aufklärung von Familien und Schutzbefohlenen, um das Problem im Ansatz zu greifen findet von staatlicher Seite jedoch wenig statt.
Es gibt mittlerweile viele nicht-staatliche Organisationen, welche gegen FGM und für dessen Visibilität kämpfen, so die Desert Flower Foundation, welche von einer Betroffenen, Waris Dirie, gegründet wurde.
Die Anatomische Rekonstruktion nach einer FGM wird mittlerweile in mehreren deutschen medizinischen Einrichtungen vorgenommen.
Trotzdem: Die wenigsten Menschen in Deutschland wissen, was FGM ist, weil kein kollektives Bewusstsein dafür herrscht.
Ein Bewusstsein, das in einer patriarchalischen Gesellschaft, die weibliche Sexualität und Geschlechtsorgane tabuisiert auch nicht geschaffen werden kann.
Diese weltweite Tabuisierung verwehrt Betroffenen den sicheren Zugang zu Hilfsangeboten. Aufklärung Leistenden können ihre Arbeit nicht uneingeschränkt ausführen.
Es braucht eine Enttabuisierung weiblicher Lust, Schmerzen, Sexualität und Geschlechtsorgane!
Es braucht Aufklärung und das Handeln Verantwortlicher Staaten und Akteur*innen in Politik und Gesellschaft!
Doch vor allem muss den Betroffenen zugehört werden!
In diesem Sinne endet dieser Text mit den Forderungen der Desert Flower Foundation!
Quellen und zum Weiterlesen:
Buch und Film: Wüstenblume von Waris Dirie
www.who.int/news-room/fact-sheets/detai…
www.desertflowerfoundation.org/de/home….
www.profamilia.de/fileadmin/dateien/fac…
uefgm.org/index.php/about/?lang=de
data.unicef.org/resources/no-time-to-lo…/
www.frauenrechte.de/images/downloads/fg…
www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/use…
www.fulda-mosocho-project.com/beschneid…/