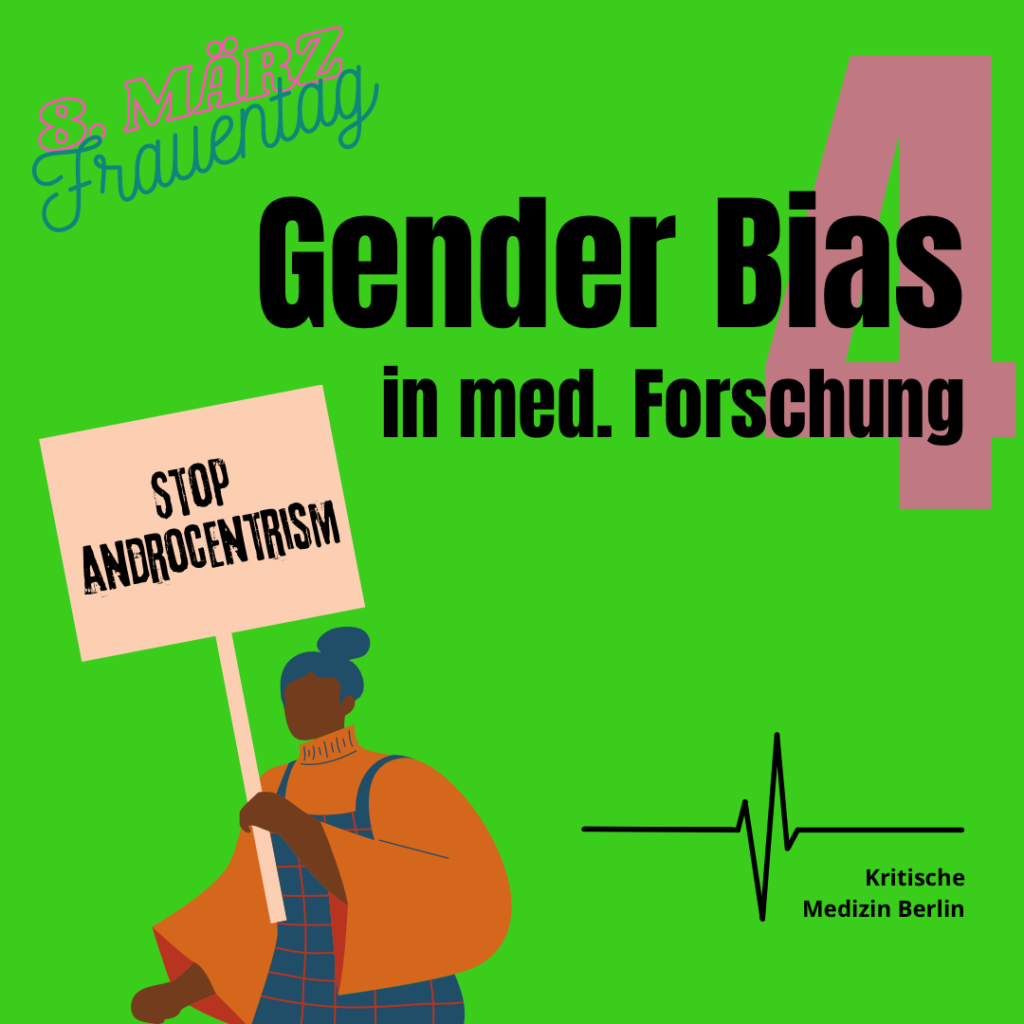Vorneweg: Wir als kritische Mediziner*innen sind der Überzeugung, dass das biologische Geschlecht sex ebenso wie das soziale Geschlecht gender fluide und die Einteilung in „Mann“ und „Frau“ längst überholt sind. (Lest dazu gerne noch mal den vorigen Text zu Medikalisierung von Geschlecht vom 3.3.21.)
Wissenschaft hängt jedoch von der Verfügbarkeit von Daten ab, die es bislang fast nur aus der androzentristischen Perspektive gibt. Daher lassen sich auch nur schwer wissenschaftliche Aussagen über bspw. Wirkung von Medikamenten bei intergeschlechtlichen Personen treffen – diese Daten werden bislang schlichtweg nicht erhoben. Die Bildung der Kategorien „Mann“ und „Frau“ in der Medizin ist ein erster Schritt weg von „Mann als Norm“. Klar ist aber, dass das Ziel die individualisierte Medizin ist, in der Patient*innen als Menschen betrachtet werden, die individuell verschieden sind und eine auf sie abgestimmte Therapie und Medikation benötigen.
Aristoteles behauptete, Frauen seien nichts anderes als „kleine Männer“. Diese Vorstellung scheint in der Medizin bis heute zu bestehen, denn hier gilt der männliche Körper nach wie vor als Norm. Alles von dieser Norm Abweichende wird als „atypisch“ oder „anormal“ qualifiziert. Dies wird am Beispiel Herzinfarktsymptomatik deutlich: Ein Herzinfarkt äußert sich bei jungen Frauen häufig in Bauchschmerzen, Kurzatmigkeit oder Übelkeit. Diese Symptome werden oft als „atypisch“ bezeichnet, da sie von dem „klassischen“, in der Leitlinie beschriebenen Bild des Mannes mit in den linken Arm ausstrahlendem Brustschmerz, abweichen. Die Folge ist, dass Herzinfarkte bei Frauen von Ärzt*innen schlechter oder gar nicht erkannt werden, spät oder fehlerhaft behandelt werden und somit die Wahrscheinlichkeit nach einem Herzinfarkt zu sterben für Frauen höher ist als für Männer. Das British Medical Journal berichtet 2016: das Risiko für junge Frauen, im Krankenhaus zu sterben, sei fast doppelt so hoch wie das von Männern. Neben Unterschieden in Auftreten, Verlauf und Ausprägung von Krankheiten bei Männern und Frauen fanden Forscher*innen in nahezu jedem Gewebe und Organsystem des Körpers geschlechtsspezifische Unterschiede. So unterscheidet sich bspw. die Lungenkapazität von Frauen und Männern, auch wenn diese Werte in Relation zur Körpergröße betrachtet werden. Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es sogar auf Zellebene: beispielsweise variiert die Expression von Proteinen, die bei der Verstoffwechselung von Medikamenten in der Leber (Biotransformation) eine wichtige Rolle spielen und damit die Wirkung von Medikamenten maßgeblich beeinflussen.
Es lässt sich also festhalten: Frauen sind nicht einfach kleine Männer!
Dennoch dominiert dieser Irrglaube auch in der Lehre: Beispielsweise in Anatomiebüchern werden zur Darstellung „neutraler“ Körperteile laut einer Studie dreimal mehr männliche als weibliche Körper abgebildet. Eine niederländische Studie von 2005 ergab, dass geschlechts- und genderspezifische Themen „nicht systematisch bei der Entwicklung des Curriculums berücksichtigt werden“. Wie sollen zukünftige Ärzt*innen für geschlechtsspezifische Unterschiede sensibilisiert werden, wenn dies kein Thema in der Ausbildung ist?
Um geschlechtersensible Medikamente und optimale Therapien zu entwickeln, bedarf es Forschung, die den Einfluss des Geschlechts auf Gesundheit und Krankheit analysiert. Hier liegt ein Problem, denn weibliche (und intergeschlechtliche) Körper wurden weithin aus der medizinischen Forschung ausgeschlossen.
Bis heute sind sie in Studien unterrepräsentiert. Obwohl beispielsweise 55% der HIV-positiven Erwachsenen in Entwicklungsländern Frauen sind und bekannt ist, dass HIV bei Frauen zu anderen klinischen Symptomen und Komplikationen führt, stellten sie laut einem Bericht über den Anteil von Frauen in der HIV-Forschung in den USA in antiretroviralen Studien nur 19,2% der Teilnehmenden; in Impfstudien waren es 38,1% und in Studien zur Heilung von HIV 11,1%.
Besonders wenige Daten gibt es über die Behandlung von Schwangeren, da sie routinemäßig von klinischen Studien ausgeschlossen werden. Es ist verständlich, dass Schwangere zögern, an klinischen Studien teilzunehmen. Dennoch sollten Gesundheitszustand und Krankheitsverläufe systematisch erfasst und dokumentiert werden. Beim SARS-Ausbruch 2004 in China wurde dies nicht getan – die WHO erklärte später: „Aufgrund dieser Datenlücke war es nicht möglich den Verlauf und die Folgen von SARS während der Schwangerschaft vollständig zu beschreiben“. Solche Lücken hätten leicht vermieden werden können und diese wichtigen Informationen fehlten uns zu Beginn der Corona-Pandemie 2020.
Ein weiteres Problem ist, dass die Forschung nach wie vor von (konservativen, weißen) Männern dominiert wird und das „Thema Gender“ als lästig empfunden wird. Eine Forscherin für öffentliche Gesundheit erzählte, sie habe auf zwei verschiedene Fördermittelanträge folgendes Feedback bekommen: „Ich wünschte, Sie würden mit diesem Geschlechterkram aufhören und sich wieder der Wissenschaft zuwenden“ und: „Ich arbeite seit 20 Jahren in diesem Bereich und der biologische Unterschied ist nicht von Bedeutung“. Dem liegt zugrunde, dass weibliche Körper für „zu komplex, zu variabel und zu teuer“ gehalten werden, um etwa in Medikamentenstudien miteinbezogen zu werden. Daher wundert es kaum, dass der Großteil der Medikamente nicht zu unterschiedlichen Zeiten des weiblichen Zyklus getestet wird. Das sei für die Forschung „zu kompliziert“, deshalb wird in der Regel in einem Zeitfenster des Zyklus getestet, in dem der Einfluss der weiblichen Hormone als relativ gering eingeschätzt wird. Im richtigen Leben jedoch spielen all diese Faktoren und Hormonschwankungen eine Rolle: Auswirkungen des Zyklus wurden bislang unter anderem bei Antihistaminika, Antibiotika, Herzmedikamenten und Antidepressiva festgestellt.
Auch in der präklinischen Forschung ist der Data-Gap groß: Eine Untersuchung von 2007 ergab, dass 90% aller pharmakologischen Artikel nur Studien an männlichen Tieren beschreiben. Weibchen werden nicht einmal dann miteinbezogen, wenn es um hauptsächlich bei Frauen vorkommende Krankheiten geht. Das hat Folgen: Wenn ein Wirkstoff in der frühen Entwicklung bei Testung an männlichen Tieren keine Wirkung zeigt, wird die Studie i. d. R. verworfen ohne zu schauen, ob der Wirkstoff bei weiblichen Tieren anders wirkt. Wie viele Therapien kamen Frauen nur deshalb nicht zugute, weil sie keine Wirkung auf die männlichen Zellen hatten, an denen ausschließlich getestet wurde? Und andersherum: Wie viele Medikamente wirken eigentlich nur oder nur optimal bei Männern? Tatsächlich ist die häufigste Nebenwirkung von Medikamenten bei Frauen, dass das Medikament schlicht nicht wirkt.
Bei Zellstudien sieht es nicht anders aus. Hier ist das größte Problem, dass die Studien das Geschlecht der Zelle oft gar nicht erst angeben. Ein Beispiel: Lange staunten Wissenschaftler*innen über die Unvorhersehbarkeit transplantierter, aus Muskeln gewonnener Stammzellen, die im kranken Muskel manchmal regenerierten, in anderen Fällen jedoch nicht. Erst spät wurde klar, dass es keineswegs unvorhersehbar war: es war abhängig vom Geschlecht der Zellen: weibliche Zellen fördern Regeneration, männliche nicht.
Dazu kommt, dass selbst wenn zu gleichen Teilen an männlichen und weiblichen Zellen/ Tieren/ Proband*innen geforscht wird, die Ergebnisse oft nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt werden bzw. keine Erklärungen gegeben werden, weshalb der Einfluss des Geschlechts auf die Ergebnisse ignoriert wurde.
Die Folge all dieser Mechanismen ist eine über lange Zeit entstandene Datenlücke hinsichtlich weiblicher Körper, die bewirkt, dass weibliche Körper in unserem System systematisch diskriminiert werden.
Es gibt Versuche, die Wissenschaft zur Berücksichtigung von weiblichen Körpern in der medizinischen Forschung zu verpflichten.
In den USA beispielsweise müssen Frauen in mit öffentlichen Geldern finanzierte klinische Studien miteinbezogen werden und die Daten nach Geschlecht analysiert werden. Dies gilt seit 2016 auch für präklinische Studien und weibliche Tiere in Tierversuchen. Ähnlich sind Regelungen in der EU und Australien. Inzwischen fordern auch einige Fachzeitschriften geschlechterspezifische Daten als Bedingung zur Veröffentlichung.
Analysen des National Institute of Health (NIH) in den USA zeigen jedoch, dass diese Regelungen schlecht durchgesetzt werden und viele Schlupflöcher bieten. So werden die meisten Studien in den USA von privaten Pharmaunternehmen durchgeführt und unterstehen damit kaum staatlichen Regularien, ebenso wie die Forschung an Generika.
Der Weg zur individualisierten Medizin (die übrigens auch vielen Männern, die nicht das Klischee des 70kg-Mannes erfüllen, zugute kommen würde) ist lang. Zuerst müssen die Datenlücken gefüllt werden. Dafür müssen systematisch so umfangreich wie möglich Daten über Krankheitsverlauf, biologische Voraussetzungen, Krankengeschichte etc. erhoben werden. Anschließend müssen die Daten analysiert werden und ihre Ergebnisse in der Entwicklung von Medikamenten aber auch in der medizinischen Praxis berücksichtigt werden. Des weiteren muss das Thema Gendermedizin dringend Bestandteil der Ausbildung werden – nicht nur im Medizinstudium, sondern überall dort, wo Forschung betrieben wird.