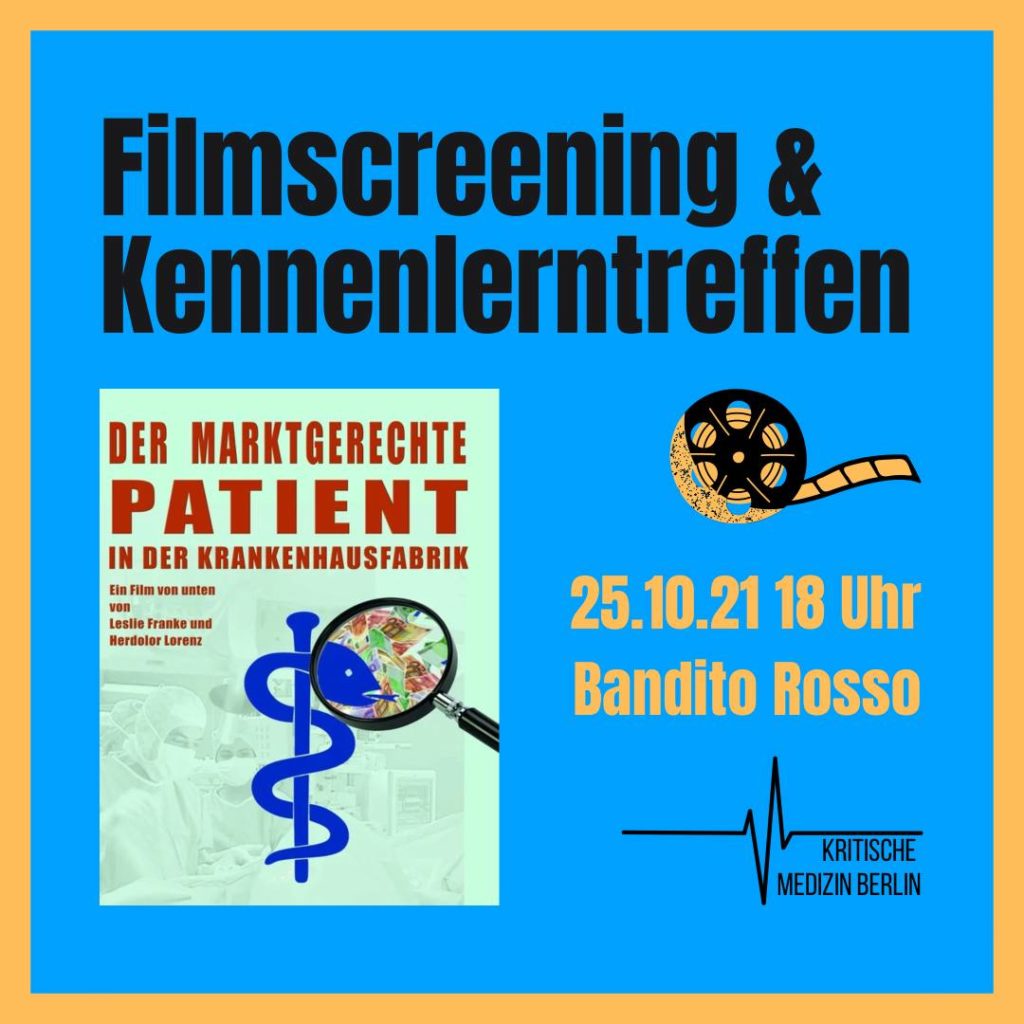Bei Knochenbruch, Krankheit und medizinischem Notfall begibt man sich in medizinische Behandlung. Auch Menschen ohne Krankenversicherung steht in der EU rechtlich vorgeschrieben eine menschenwürdige medizinische Basisversorgung zu. In Deutschland jedoch sind bestimmte Gruppen von Menschen strukturell von ihrem Recht auf Gesundheit ausgeschlossen: In vielen europäischen Ländern können die Ärzt*innen nach der Behandlung die Kosten von Ämtern zurückfordern. Deutschland stellt sich mit einer praxisfernen Gesetzgebung dagegen und verwehrt vor allem Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus ihr Recht auf Gesundheit.
Rechtliche Grundlagen
1. Theoretisch haben Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus ein Recht auf grundlegende Gesundheitsversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Darin inbegriffen sind z.B. akute Erkrankungen oder Schmerzzustände, Schwangerschaften sowie Impfungen und Einzelfälle, in denen eine Behandlung zur Sicherung der Gesundheit notwendig ist. Für die Kostenübernahme können Behandlungsscheine beim Sozialamt beantragt werden, da Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus über keinen Versicherungsschutz verfügen.
2. Gleichzeitig sind öffentliche Stellen, zu denen auch die Sozialämter gehören, verpflichtet, Namen und Adressen von Personen ohne Aufenthaltstitel an die Ausländerbehörde zu melden (§87 Aufenthaltsgesetz; sogenannte Übermittlungspflicht).
3. Weiterhin können die Sozialämter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einen Datenabgleich mit der Ausländerbehörde vornehmen, um personenbezogene Daten der Leistungsberechtigten zu überprüfen.
Falls die Ausländerbehörde die Daten von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus erhält, droht ebendiesen die Verhaftung und Abschiebung. Aus Angst, abgeschoben zu werden, nutzen viele Betroffene ihr Recht auf Gesundheit, wenn überhaupt, nur im äußersten Notfall.
Behandlung im Notfall
Medizinisches Personal ist im Notfall verpflichtet, allen Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zu helfen. Eine Kostenerstattung für die Krankenhäuser kann bei den Sozialämtern beantragt werden. Daraus folgt ein verlängerter Geheimnisschutz der Sozialbehörden – sie dürfen also nicht direkt die Ausländerbehörde bzw. die Polizei im Sinne der Übermittlungspflicht kontaktieren. Ob dies in der Praxis allerdings tatsächlich so eingehalten wird, ist nicht sichergestellt. Außerdem gilt der verlängerte Geheimnisschutz nicht für die Regelung des Datenabgleichs. Daraus folgt, dass die Sozialämter trotzdem rechtlich in der Lage sind, Daten indirekt an die Ausländerbehörde zu übermitteln. Der sogenannte Nothelferparagraph soll regeln, dass Krankenhäuser ihre Kosten erstattet bekommen, wenn die Betroffenen nicht schnell genung einen Behandlungsschein beantragen können. Dieser Paragraph greift allerdings nur unter realitätsfernen Bedingungen: So muss z.B. die Bedürftigkeit der Betroffenen durch Kontoauszüge, Miet- oder Lohnabrechnungen, etc. nachgewiesen werden. Bei Personen ohne Aufenthaltstitel sind diese Dokumente in den meisten Fällen nicht vorhanden. Das führt dazu, dass Krankenhäuser aufgrund der Sorge, ihre Kosten nicht erstattet zu bekommen, oft erst dann zu einer Behandlung bereit sind, wenn die Betroffenen eine Kostenübernahme unterschrieben oder einen Vorschuss gezahlt haben. Die Krankenhäuser machen sich somit unter Umständen sogar der Unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Nicht zuletzt kontaktieren auch Krankenhausbeschäftigte häufig direkt die Polizei, wenn sie Patient*innen ohne Aufenthaltsstatus vor sich haben. Sie verletzen damit die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht. Diese gilt übrigens auch für sogenannte berufsmäßig tätige Hilfen, z.B. das Verwaltungspersonal einer Klinik.
Europäischer Vergleich
Deutschland ist das einzige Land Europas, in dem die Übermittlungspflicht noch existiert. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist in allen anderen Ländern zwar regional noch sehr unterschiedlich, doch in keinem Land müssen Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus eine Abschiebung riskieren, wie es in Deutschland der Fall ist.
England: Der Datenaustausch zwischen Innenministerium und dem nationalen Gesundheitsdienst NHS wurde 2018 von der englischen Regierung beendet, nach dem es einen massiven Druck von der Seite des medizinischen Personals sowie der Zivilgesellschaft gab.
Schweden: Seit einer Gesundheitsreform im Jahr 2013 müssen Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus nicht mehr selbst für ihre Behandlungen aufkommen, sondern haben für ein Entgelt von 5 Euro Anspruch auf grundlegende medizinische Versorgung, wie sie Asylbewerber*innen zusteht. Diese kann – je nach Region Schwedens – auch über die Mindestversorgung hinausgehen und der Gesundheitsversorgung schwedischer Staatsangehöriger gleichkommen.
Spanien: Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus müssen sich für einen uneingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung im Gemeinderegister eintragen lassen. Auf dieses hat die Polizei bzw. Ausländerbehörde jedoch keinen Zugriff. Mit einer Unterbrechung von 2012-2018, während der diese Regelung durch die konservative Regierung außer Kraft gesetzt wurde, hat Spanien damit eines der inklusivsten Gesundheitssysteme.
Verstoß gegen Menschenrechte und Grundgesetz
Laut der UN-Menschenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, für alle Menschen „das für {sie} erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit“ sicherzustellen. Deutschland hat diese Konvention unterschrieben. Mit der Übermittlungspflicht, die ganze Gruppen von Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, von einer grundlegenden Gesundheitsversorgung ausschließt, verstößt die Bundesrepublik Deutschland damit gegen dieses Menschenrecht. Erst 2018 forderte ein UN-Ausschuss die Bundesregierung dazu auf, die Übermittlungspflicht abzuschaffen. Die Übermittlungspflicht verstößt auch gegen die deutsche Verfassung: Die Würde des Menschen ist im Grundgesetz das höchste Gut. Sie wird über ein grundlegendes Existenzminimum definiert, zu dem das Bundesverfassungsgericht auch die Gesundheit zählt. Der Gesetzgeber ist nach dem Sozialstaatsprinzip zur Sicherstellung dieses Existenzminimums verpflichtet; Deutschland bewirkt mit der Übermittlungspflicht jedoch genau das Gegenteil und verhindert stattdessen, dass die Würde von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus gewährleistet wird. Des Weiteren werden durch den praktisch eingeschränkten Zugang auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sowie das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt.
Abschaffung der Übermittlungspflicht
Bisherige Reformvorschläge der Übermittlungspflicht von Grünen, Linken und SPD zur Übermittlungspflicht wurden bisher immer von CDU/CSU abgelehnt. In dem Reformvorschlag wäre die Übermittlungspflicht auf Strafverfolgungseinrichtungen und Polizei begrenzt gewesen. Nachdem einige Länder bereits seit Mitte der 2000er die Meldepflicht für Schulen von Kindern ohne Aufenthaltsstatus aussetzten, legte der Bund im Jahr 2011 nach: Schulen und Kindergärten wurden von der Übermittlungspflicht ausgenommen.
Für die Sicherstellung des Rechts auf Gesundheit gibt es lokale, staatlich finanzierte Initiativen, wie die Clearing-Stellen für Menschen ohne Krankenversicherung oder das Projekt des Anonymen Krankenscheines in Thüringen. Letzteres wurde nach einem Regierungswechsel wieder aufgekündigt. Jedoch liegt die Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung mit den Medibüros und Medinetzen, sowie den Maltesern und weiteren Hilfsorganisationen, zum Großteil in rein ehrenamtlicher Hand. Trotz der wichtigen Arbeit der ehrenamtlichen Akteur*innen kann das Recht auf Gesundheit nicht umfassend umgesetzt werden.
Deswegen fordern wir: Die Abschaffung des §87 Aufenthaltsgesetz, damit endlich allen Menschen eine menschenwürdige Gesundheitsversorgung zukommen kann. Wir unterstützen die Kampagne „Medizinische Versorgung steht allen zu! Übermittlungspflicht jetzt einschränken!“
Unterschreibt die Petition jetzt!
Quellen:
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/56867/uebermittlungspflicht-aufgehoben
https://gleichbehandeln.de/wp-content/uploads/2021/05/210504_RZ_GFF_Studie_Recht-auf-Gesundheit_screen_DS.pdf
Medinetze/Medibüros: https://medibueros.org/
Clearingstellen: https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/resource/blob/203274/1594458/49cd7b962c4bd4701c329ed50025dad2/verzeichnis-clearingstellen-2020-data.pdf